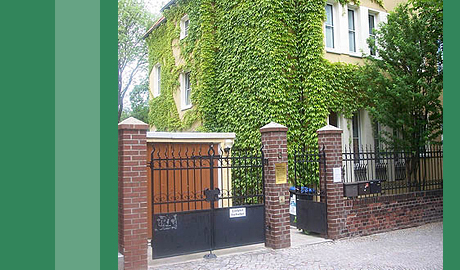
Zahnärztin
Dipl.-Stom. Kerstin Fischer
Friedensstr. 6
06114 Halle
Telefon: (0345) 5 23 30 31
Telefax: (0345) 5 22 36 11
Gesundheitsnachrichten
„Stabile Gesundheitsversorgung als Stabilitätsanker unserer Demokratie“
Die vier führenden Verbände in der Gesundheitsversorgung ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) haben eine Allianz für ein „starkes, resilientes Gesundheitssystem“ geschlossen. In einem gemeinsamen Positionspapier beschreiben sie die Vision eines leistungsfähigen Gesundheitssystems als Basis einer demokratischen Gesellschaft und damit zugleich auch des sozialen Friedens.
Deutlich kritisieren die Institutionen die Gesundheitspolitik der vergangenen Legislaturperiode. „Sie war geprägt durch ein bisher nicht bekanntes Maß an Misstrauen gegenüber der Selbstverwaltung, aber auch gegenüber den Leistungserbringern in Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken“, heißt es im Papier.
Die Verbände fordern einen konsequenten „Politikwechsel in der Gesundheitspolitik“ und bieten dafür ihre Zusammenarbeit und Expertise an. In sieben Punkten skizzieren sie ihre Vorstellungen und Forderungen. So wollen sie unter anderem gemeinsam mit der Politik praxisnahe und bürokratiearme Lösungen zur Entlastung des Gesundheitssystems schaffen sowie den Prozess der Digitalisierung patientenorientiert vorantreiben – und zwar mit positiven Anreizen und ohne Sanktionen.
Weitere inhaltliche Schwerpunkte bilden die Entwicklung effektiver Präventionsprogramme, der Einsatz für eine sektorenübergreifende Notfallversorgung sowie eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem weltoffenen und werteorientierten Gesundheitssystem.
Thomas Preis, Präsident der ABDA: „Mit unserem gemeinsamen Papier senden wir ein deutliches Signal der Geschlossenheit an die neue Bundesregierung. Die neue Koalition muss mit Blick auf den demographischen Wandel die gesamte wohnortnahe Gesundheitsversorgung schnell stabilisieren, anstatt sie – wie es seit Jahren beispielsweise bei den Apotheken der Fall ist – von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abzukoppeln. Ein ‚Weiter so!‘ würde zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung aller Bürgerinnen und Bürgern führen.“
Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG, fordert: „Nach drei Jahren der Sprachlosigkeit brauchen wir wieder einen konstruktiven ehrlichen Dialog, um nachhaltige Lösung für die Gesundheitsversorgung zu schaffen. Die Herausforderungen sind zu groß, als dass diese in einem Gegeneinander zu lösen wären. Politik muss Entscheidungen treffen, aber dazu braucht es im Vorfeld den Austausch mit der Selbstverwaltung und den Praktikern im System.“
Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der KBV, erklärt: „Die vergangenen Jahre waren gesundheitspolitisch verlorene Jahre. Die Rahmenbedingungen sind in fast allen Bereichen eher noch schlechter geworden. Wir setzen auf einen Neuanfang, denn Politik ist gut beraten, mit uns zu sprechen, also denjenigen, die am besten wissen, wie Versorgung vor Ort organisiert wird – und die vor allem nah bei den Patientinnen und Patienten sind.“
Martin Hendges, Vorstandsvorsitzender der KZBV, führt aus: „Der gesundheitspolitische Kurs der letzten drei Jahre war geprägt von kurzsichtiger Kostendämpfung und weitestgehender Ignoranz gegenüber den Selbstverwaltungspartnern. Will man die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen wirklich meistern, muss die Prävention Leitbild der Gesundheitsversorgung sein. Die Selbstverwaltungspartner stehen hierfür mit ihrer Expertise und den Erfahrungen aus dem Praxisalltag bereit.“
Täuschung im Kopf?
Rückenschmerzen treten weltweit immer häufiger auf – ein Problem, das mit unseren veränderten Lebensgewohnheiten, Arbeitsbedingungen und auch psychosozialen Faktoren zusammenhängt. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass Rückenschmerzen früher oft nicht diagnostiziert oder gemeldet wurden. Die steigenden Fallzahlen könnten daher sowohl auf eine tatsächliche Zunahme als auch auf eine verbesserte Diagnostik und ein höheres Bewusstsein für das Problem zurückzuführen sein. „Die eigentliche Herausforderung bei den meisten Menschen besteht darin, präventive Maßnahmen in den Alltag zu integrieren, bevor der Schmerz chronisch wird.“ sagt Sportwissenschaftler Markus Zodel.
Nach dem Zweiten Weltkrieg begünstigten der Ausbau des Gesundheitswesens, bessere soziale Absicherungen und die wachsende Rolle der Orthopädie die verbreitete Empfehlung von Bettruhe als Therapie. Doch langfristige Bettruhe wurde später als problematisch erkannt – Studien zeigen, dass sie in vielen Fällen das Risiko einer Chronifizierung erhöht. Zudem führte die Erwartung, Ärzte müssten alle Schmerzen lindern, zu unrealistischen Vorstellungen und zu einer steigenden Zahl von Patienten mit chronischen Beschwerden.
Während chirurgische Eingriffe vielen halfen, blieben bei anderen anhaltende Beschwerden nach gescheiterten Operationen bestehen. In vielen Fällen lässt sich eine Verbesserung ohne drastische Maßnahmen erzielen – oft genügt nur Bewegung. Neben gezielten Kräftigungsübungen kann es Wunder wirken, den Arbeitsplatz bewegungsfreundlicher zu gestalten. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der Haltungswechsel ermöglicht, ist dafür ein guter Anfang. "Wer sich mehr bewegt und auf ergonomisches Arbeiten achtet, merkt oft schneller eine Besserung.“ empfiehlt Herr Zordel.
Obwohl Bewegung seit Jahrzehnten empfohlen wird, nimmt die Prävalenz chronischer Rückenschmerzen weiter zu. Laut einer aktuellen Studie im Fachmagazin The Lancet sind Rückenschmerzen die weltweit häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Im Jahr 2020 waren 619 Millionen Menschen betroffen, und bis 2050 könnte diese Zahl auf 843 Millionen steigen.
Doch warum nehmen chronische Rückenschmerzen immer weiter zu? Könnte es sein, dass sie eher mit dem Gehirn als mit rein körperlichen Ursachen zusammenhängen? Viele Experten beziehen sich dabei auf die pawlowsche These. Im berühmten Pawlow-Experiment reichte das bloße Läuten einer Glocke, um bei einem Hund Speichelfluss auszulösen – selbst ohne Futter. Ähnlich kann es bei chronischem Schmerz sein: Der ursprüngliche Auslöser ist nicht mehr erforderlich, um Schmerzen hervorzurufen. Andere Reize können die gleiche Reaktion auslösen.
Wenn jemand davon überzeugt ist, eine Verletzung zu haben, sendet das Gehirn ein Alarmsignal und erzeugt Schmerz, um den Körper zu schützen. So entsteht die Vorstellung, dass bestimmte Bewegungen die Ursache des Schmerzes sind - konditionierte Reaktionen. Chronischer Schmerz könnte also eine erlernte Reaktion aufgrund einer ungenauen Kodierung der ursprünglichen Verletzung sein. Das gespeicherte Bild dieser Verletzung kann im Gehirn unscharf werden, sodass es ähnliche Bewegungen oder Situationen mit der ursprünglichen Verletzung verknüpft – ein Prozess, der als „Reizgeneralisierung“ bekannt ist. Dadurch können neuronale Muster aktiviert werden, ohne dass der ursprüngliche Reiz vorhanden ist.
Konditionierte Reaktionen können in unterschiedlichsten Kontexten auftreten: bei bestimmten Nahrungsmitteln, Stress, Emotionen, Gerüchen, Umgebungen sowie Bewegungen und Aktivitäten. “Dies führt oft zu Schonhaltungen, Vermeidungsverhalten und einer zunehmenden Einschränkung im Alltag", erklärt Herr Zordel. Durch gezieltes Training kann das Gehirn sich neu ausrichten, fehlerhafte neuronale Muster – sogenannte Neurotags – überarbeiten und korrigieren.
Letztendlich kann das Nervensystem lernen, Schmerz nicht mehr als Bedrohung wahrzunehmen. Schritt für Schritt gewinnt der Körper das Vertrauen in seine Bewegungen zurück – und mit der Zeit kann der Schmerz nicht nur nachlassen, sondern sogar ganz verschwinden. “Der Schlüssel zur Schmerztherapie liegt nicht nur im körperlichen Training, sondern auch im Umdenken", betont Zordel und ergänzt: “Bewegung kann helfen, das Gehirn neu zu programmieren und den Schmerzkreislauf zu durchbrechen.”
Chronischer Schmerz ist eine komplexe Erfahrung, doch die Hoffnung bleibt: Das Gehirn ist anpassungsfähig und kann sich stetig verändern.
proDente legt Magazin „Füllungen“ neu auf
Ein defekter Zahn kann nicht nur furchtbar schmerzen, sondern stellt Betroffene auch vor die Frage: Welche Versorgung ist für mich die richtige? Das Magazin „Füllungen“ stellt die verschiedenen Möglichkeiten dar. Im Fokus stehen dabei die sogenannten Einlagefüllungen wie Inlay, Onlay und Overlay (Teilkrone).
Es ist passiert: Trotz sorgfältiger Mundpflege haben Kariesbakterien einen Zahn geschädigt. Er bekommt eine Füllung. Aber auch Defekte, die nicht durch Karies entstehen, können eine Füllung notwendig machen. So bei nächtlichem Zähneknirschen, einem Unfall, Zahnerosionen oder bei angeborenen Fehlentwicklungen. Bei kleinen und mittleren Schäden kommen plastische Füllmaterialien zum Einsatz. Die Zahnärztin oder der Zahnarzt kann sie direkt in den Zahn einbringen. Auch größere Defekte können damit im Backenzahnbereich versorgt werden. „Große Zahnfüllungen haben allerdings langfristig gesehen höhere Risiken für Brüche der Füllungen oder des Zahnschmelzes“, erläutert Dr. Romy Ermler, Vorstandsvorsitzende der Initiative proDente e.V. und Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). „Daher sind sogenannte Einlagefüllungen wie Inlays, Onlays oder Overlays eine langlebige Alternative.“
Inlay, Onlay, Overlay: Füllungen aus dem Dentallabor
Einlagefüllungen bestehen aus Materialien wie Goldlegierungen oder Keramik. Die Zahntechnikerin oder der Zahntechniker stellen sie nach den Vorgaben aus der Zahnarztpraxis individuell im Dentallabor her. Die fertige Füllung setzt die Zahnärztin oder der Zahnarzt dann in den defekten Zahn ein. Die einzelnen Versorgungen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften und in ihrem Preis. Welches Material geeignet ist, ist unter anderem abhängig von der Größe und Lage des Defekts sowie von den individuellen Ansprüchen an die Versorgung. Nicht zuletzt müssen auch die Kosten in das Budget der Patientin oder des Patienten passen. Denn die gesetzliche Krankenkasse trägt die Kosten in Höhe der Grundversorgung mit einer Füllung. Der größere Teil wird privat abgerechnet.
Kostenfrei bei proDente bestellen
Patientinnen und Patienten können das Magazin „Füllungen“ bei proDente per E-Mail an info@prodente.de, auf www.prodente.de unter dem Menüpunkt „Infomaterial für Patienten“ oder unter der Telefonnummer 01805-55 22 55 beziehen.
Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie zahntechnische Innungsbetriebe erhalten je 100 Exemplare des Magazins „Füllungen“ kostenfrei per E-Mail an info@prodente.de, auf den Fachbesucherseiten unter www.prodente.de (Login) oder über die Telefonnummer 01805-55 22 55.
